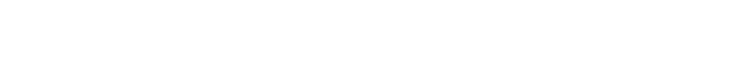Rising Osun
Jeder Mensch hat ein Gefühl dafür, dass er etwas ganz Spezielles in sich trägt, die ganz andere Form der Person, die sich abhebt von anderen, andererseits muss man sagen, natürlich sind wir sehr stark abhängig von den Zuschreibungen anderer Menschen; auch wenn man sich sehr genau selbst befragt, zum Beispiel in einer Therapie, wo das natürlich Thema ist, wird man sagen müssen, ‚Ich bin mal das, ich bin mal das, nicht ganz beliebig, ich habe schon etwas, was ich als mein ganz Eigenes ansehe, aber ich bin mir dessen bewusst, dass sich das auch verändern kann‘. (Eva Jaeggi)
(I)
Als Kind eines Schwarzen Vaters und einer weißen Mutter war Rassismus ein Teil meines Lebens. Ich bin mit 6 Jahren in das Ballettzentrum John Neumeier/Hamburg aufgenommen worden. Dort war ich das einzige Schwarze Mädchen. Es gab keine erwachsene, schwarze Tänzerin in der Tanzschule, die ich als Vorbild hätte haben können. Ich war also die einzige „Andere“. Erstmal nicht auffällig negativ. Durch meinen Fußbau und meine Physiognomie kam ich jedoch technisch schnell an meine Grenzen im klassischen Ballett. Ich musste mich sehr verbiegen, um auf die Spitzen zu kommen, so dass ich oft frustriert war und die Ausbildung mit 12 Jahren, mit dem Gefühl meine ganze Energie nicht ausschöpfen zu können, beendete.
Ich wollte mich mehr austoben und nicht mehr das Gefühl haben, mich kontrollieren und weiter quälen zu müssen. Außerdem wollte ich nicht mehr die einzige „Andere“ sein. Ich wollte einfach dazugehören und nicht immer rausstechen.
Im klassischen Ballett wird einem sehr schnell klar gemacht, welchen Körper man haben muss, um es nach oben zu schaffen. Diesen Körper hatte ich nicht.
Später, im Eiskunstlaufen, war ich wieder einmal die einzige Schwarze, was dazu führte, dass ich Surya Bonaly genannt wurde. Sie war die einzige Schwarze Eiskunstläuferin, die den gefährlichen Flic-Flac auf dem Eis schaffte. Den habe ich nie gemacht, und doch war da immer diese Erwartung, das habe ich oft gespürt. Dieser Druck, den Menschen zu gefallen und den Erwartungen - bestimmten Vorstellungen - zu entsprechen.
Irgendwann war ich dann allerdings auch zu groß für meine (Eiskunstlauf-)Kategorie, so dass ich diese Welt ebenfalls verließ.
In meiner weiteren Laufbahn arrangierte ich mich eigentlich immer so, dass es für mich passte. Ich hatte Jobs als Backgroundtänzerin, choreografierte für Künstler:innen und hielt mich als Tänzerin und Performerin viel auf Bühnen auf — immer mit dem Gefühl, eigentlich eine gute Position zu haben und sein zu können, wie ich bin. Im Nachhinein betrachtet, habe ich es mir schöner geredet als es war: dass Menschen es nämlich exotisch fanden mich zu buchen, und mich im Sinne einer „Quote“ dabeihaben wollten.
Heute weiß ich, dass ich vor lauter Selbstschutz nicht merkte, wie toxisch diese Erlebnisse waren. Ich war immer die Einzige, und es wurde immer „positiv“ dargestellt. Eine Position, die ich oft missverstanden habe.
Kommentare wie: „Deine Haut ist so schön”, „du kriegst keinen Sonnenbrand”, „du hast so kuschelige Haare“ usw. gaben mir das Gefühl, besonders zu sein. Und so war ich auch immer die Person, auf die Menschen neidisch waren. Das gab mir eine Zeit lang Kraft, weiterzumachen. Ich bekam ja ständig Bestätigung...
In den letzten 2 Jahren, in denen ich mich intensiver mit dem Thema befasse, ist mir jedoch aufgefallen, wie ungesund und rassistisch geprägt all diese Stationen waren. So harmlos mir die vielen Erfahrungen auch erschienen,— das Gegenteil ist der Fall —: weil sie so vermeintlich normal waren, musste ich mir ihre bittere, subtile Wirkung erst vergegenwärtigen.
Menschen, die im Alltag doofe Kommentare mir gegenüber machen, sind für weiße Menschen nur schlecht gelaunt, für mich leider erstmal gegen mich; auch wenn es nicht so ist, ist mein erster Gedanke: „Mein Aussehen ist das Problem!“
Diese alltäglichen Bemerkungen aus meinem Umfeld hatten einen großen Einfluss auf meine künstlerische Laufbahn und auf mein Verhalten. Ich habe mich von „positivem“ Rassismus bestärkt gefühlt! Bei Bemerkungen wie „Du kannst so gut tanzen, du hast das ja im Blut!“ konnte ich mich nur schwer rechtfertigen und habe lange unbeholfen gelächelt. Zu lange, denn die Sätze klangen zunächst wie Komplimente, blieben im Nachgang allerdings als giftige Abfälligkeiten in mir lebendig. Was war mit meinem Einsatz, meinem Fleiß, meiner Anstrengung und Ausbildung - zählten diese Anteile nicht?!
Nach zwei Musical-Engagements mit Rollen die, so gesehen „zu mir passten“, merkte ich immer mehr, wie stereotyp diese Rollen waren, in die ich rein gequetscht wurde.
Kommentare von weißen Produzent:innen wie: „Sarah, you are doing too much”, „Sarah not so loud”, „Sarah dear, don’t exaggerate!“ führten dazu, dass ich mich kleiner machte und zunehmend leiser wurde... ich musste also auch das Musical-Geschäft dringend verlassen! Diese Welt war nicht die richtige für mich. Es ging nicht um meine Geschichte, sondern um Geschichten, die aus der Sicht von weißen Menschen erzählt werden.
Und andererseits bestärkten mich diese Art von Bemerkungen auch, denn in mir wuchs ein mich antreibender Gedanke: „Jetzt erst recht, da wo ich als zu laut und zu viel gesehen werde, da möchte ich nicht sein. Ich löse mich davon und finde einen besseren Ort, an dem ich laut und viel sein kann!”
Wirklich empowernde Erfahrungen hatte ich dann mit der Gruppe STOMP.
Dort öffnete sich eine Welt, in der ich nie „zu viel“ war. Der Regisseur und der Produzent sagten mir wiederholt in der Probephase: „Sarah, I will never tell you to do less nor to stop, Sarah go for it!“
Ab da war mir klar, dass ich angekommen war. Ich kann kaum beschreiben, was für ein überwältigendes Gefühl es war, das erste Mal mit der Kraft auf die Bühne zu gehen, die ich wirklich in mir habe, ohne Energie zu sparen oder mich verstellen zu müssen!
Dieses „zu doll und zu viel“ hat mich im Grunde immer stärker gemacht. Ich musste nur einen Ort finden, an dem ich so sein kann, wie ich bin, mit all dem was ich mitbringe. In der Bühnenshow STOMP habe ich die Rolle der Haupt-Trommel bekommen: Sie ist die Person, die innerhalb einer Mehrheit von Männern den Puls angibt. Sie trägt eine orange Trommel um den Hals und schlägt mit einem Holzschläger drauf. So erzeugt sie den Bass Sound (Bassdrum eines Schlagzeuges).
Ein starkes Bild, das Kraft gibt. Von dieser Kraft und diesem Selbstwertgefühl werde und bin ich bis heute in verschiedenen Situationen getragen. Insgesamt bin ich mit STOMP sieben Jahre lang durch die Welt getourt.
(II)
Mit meinem Körper als Projektionsfläche für Vorurteile beschäftige ich mich erst seit Kurzem. In den Augen von vielen Menschen hat dieser (mein) Körper mit Urlaub, Unbeschwertheit, exotischen Früchten, Stärke, Wärme und Freude zu tun. Die Gegensätze dieser Vorstellungen, die ich als Mensch auch erlebe – Arbeit, Probleme „unreife Früchte“, Schwächen und Trauer – diese werden mir in der weißen Mehrheitsgesellschaft nicht zuerkannt. Diese Art Fremdbestimmung macht es mir oftmals schwer, meine eigene Person zu zeigen oder meinem Charakter gemäß zu leben. Ich werde ständig mit Vorurteilen konfrontiert, gegen die ich mich wehren muss und die mich vulnerabel machen.
Dann tanze ich „wie auf rohen Eiern“. So haben sich mein Körper und auch meine Seele bis jetzt verhalten. Ich habe versucht mich anzupassen, zu gefallen und war dadurch nicht in meiner vollen Kraft.
Eine zentrale Frage, die ich mir stelle, lautet: „Wie kann ich den Blick des passiv Zuschauenden transformieren und ihn für mich und meinen Tanz nutzen?
Solange ich das Konstrukt – die Konstellation – Darsteller:in und Zuschauer:in erlebe, ist es für mich schwer, Bewertung zu ignorieren. Wenn ich aber die Zuschauer:innen in den Raum der Darsteller:innen einlade, wechselt und weitet sich der Blick. So geht beispielsweise im öffentlichen Raum eine Tür auf. Da beginnt für mich die Transformation.
Meine Erfahrungen im öffentlichen Raum haben mir gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt den Blickwinkel und auch meine Perspektive zu verändern. Im öffentlichen Raum, z.B. auf der Straße, ist die aktiv performende Person genauso wenig geschützt wie die passiv Zuschauende. Dort kann ich Raum vergrößern und die Passiven zu Aktiven machen – daraus ergibt sich für alle ein Perspektivwechsel! Bewertung und Verurteilung finden dann nur noch bedingt statt. Die Positionen ändern sich und alles ist offen!
Durch den Positionswechsel kann meines Erachtens eine urteilende Person spüren, wie es sich anfühlt, bewertet und auch verurteilt zu werden. Durch einen solch erweiterten Blickwinkel entsteht idealerweise Verständnis und (Nach-)Empfinden – Empathie. Menschen werden dann auch bescheidener.
Die Bühne hat eine große Kraft und Macht. Sie kann Sprachrohr für Viele sein.
Über eine Bühne kann ein Mensch jegliche Art von Information vermitteln, die über den Bühnenraum hinaus Gewichtung bekommt. Eine Bühne hat viele Augen und Ohren, kann viele Menschen erreichen. Also müssen wir erst die Bühne/Bühnen selbst dekolonisieren und strukturell verändern, um neue Möglichkeiten zu finden und neuartige Ideen zu realisieren.
Ich möchte Formate kreieren, in denen Menschen sich zusammentun und auf einer Bühne neue Wege ersinnen und sich austauschen. Diskussionen können zum Mittelpunkt und zum Teil der Performance werden, Rollen auf der Bühne gewechselt, Hierarchien aufgebrochen werden. Unser Leben kann auf der Bühne in Echzeit gezeigt, ... und so zur Performance werden. So tragen bekannte, unbekannte oder unerwähnte Geschichten zu einem ‘change through performance’ zu einem ‘(e)motional enrichment’ bei.
Machtstrukturen, wie sie in der „klassischen“ Bühnenwelt existieren, müssen endlich aufgebrochen werden. Grundsätzlich finde ich es wichtig, Macht performativ aufzuspüren, und auch mit meinem Körper zu überlegen, was man aufgeben muss, um alte Muster zu überwinden und neue Denkweisen und auch neue Körper und Körpersprachen zu kreieren.
Ich möchte den Platz haben, besonders und als Mensch gleichwertig zu sein.
Unsere Gesellschaft ist so stark von einem kolonialem Mindset geprägt, dass wir offener und flexibler werden und in Kommunikation und Austausch gehen müssen, um neue Denkweisen zu finden. Wenn wir koloniale Muster bewahren und aufrechterhalten, kommen wir nicht weiter. BEWEGEN wir uns also gemeinsam weiter!
Zitiervorschlag
Lasaki, Sarah. 2021. “RISING OSUN“ In: Moving Interventions 1: Ambiguous Potentials // Performative Awakenings, December 2021. Edited by / Herausgegeben von: Sarah Bergh and Sandra Chatterjee, with Ariadne Jacoby (CHAKKARs – Moving Interventions), translated by: Sandra Chatterjee, copyedited by: Veronika Wagner. Published by /veröffentlicht von CHAKKARs – Moving Interventions.
Über die Autorin
Sarah Lasaki, gebürtige Hamburgerin mit Wurzeln in Nigeria der Schweiz und Frankreich ist seit 20 Jahren professionelle Tänzerin und arbeitet projektbezogen seit 10 Jahren intensiv mit jungen Menschen im Bereich Tanz und Musik.
Von 2007-2015 war Sarah mit der Erfolgsshow „ STOMP“ weltweit unterwegs und beschäftigt sich seitdem mit der Verschmelzung von Tanz und Bodypercussion. Sie wirkte als Choreographin/Tänzerin in einigen Kampnagel Produktionen mit Mable Preach, Yolanda Gutierrez, Ursina Tossi, Israel Sunday Akpan oder Regina Rossi. Zuletzt hat sie mit dem M.A.R.K.K, Mbassy Hamburg (Bisrat Negassi) und Come In Tent (Claude Jansen) gemeinsam mit ihrer festen Jugendgruppe L.I.N.E.S an dem Projekt „Re-Enactement of Things“ gearbeitet. Sie gehört zum festen Team des „ Body Rhythm Hamburg“ Festivals und arbeitet gerade an ihrem Solo über „Identität“.