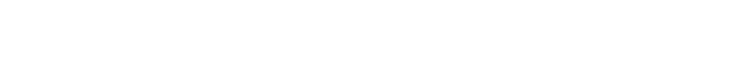Wider_ständig
Kulturpraxis wider_ständiger gestalten durch Bewegen, Bewegungen und (miteinander) in Bewegung sein
Ich tanze nicht, zumindest nicht professionell. Aber ich bin „in Bewegung“ mit tanzenden Menschen, Menschen aus dem Tanzberuf, Tänzer*innen, Choreograf*innen, Tanzpraktiker*innen, -künstler*innen und -theoretiker*innen. Ich bewege mich gerne gedanklich, auch wenn mir die körperliche Bewegung nicht immer leichtfällt. Vielleicht suche ich auch den Kontakt zu tanzenden Menschen, um diese vermeintliche Binarität in mir aufzuheben. Denn binäres Denken und Handeln steht der Vorstellungskraft und damit der Erzeugung vieler verschiedener möglicher Welten im Weg. Und ist grade nicht der künstlerische Bereich das Feld, das Möglichkeitsräume aufzeigt (oder zumindest andeuten kann) und gleichzeitig Begegnungsräume schafft? Und wie schöner zusammenkommen als durch Tanz?
Das ist selbstverständlich eine Idealvorstellung, denn gerade auf professioneller Ebene ist Tanz auch ein Beruf, ob als tanzende Künstler*in, Choreograf*in oder in einem der vielen anderen Bereiche, die mit dem Tanz-Schaffen verbunden sind. In dem Kontext von Tanz als Kulturproduktion schleichen sich zwangsläufig Verwertungslogiken ein, so zum Beispiel Fragen von Finanzierung und Tourbarkeit. Wie kann also kritische Tanzarbeit aussehen? Wie können liminale Räume von (Selbst-)Kritik, (Selbst-)Ermächtigung und Zusammenkunft geschaffen werden?
Kritisch in Bewegung sein – patriarchal-kapitalistischen Anrufungen widerstehen
Meine ersten Gedanken für diesen Text drehten sich rund um Praktiken des (Aus)Ruhens. Es gibt nicht zuletzt wegen der desaströsen COVID-19-Pandemie eine breitere Auseinandersetzung mit der Erschöpfung, die viele Menschen erfasst – ob physisch, psychisch, emotional oder seelisch. Die Pandemie hat die prekäre Existenz vieler Kulturpraktiker*innen sichtbarer gemacht, weshalb nun auch Prozesse finanziell gefördert werden. Das heißt, dass nicht immer jede Idee gleich in ein Projekt übersetzt und produziert werden muss, sondern auch die Weiterentwicklung von Gedanken als eine legitime Beschäftigung für Menschen im Kulturbetrieb gilt. Manche Menschen in diesem Berufsfeld waren vorher schon erschöpft, wegen der Sorgearbeit, die sie für Kinder, Familie, Freund*innen oder Verbündete leisten, wegen Behinderungen, Neurodivergenzen oder chronischen Krankheiten in einer zutiefst ableistischen Gesellschaft, wegen kontinuierlichen Rassismuserfahrungen in einer weißen Dominanzgesellschaft, wegen wegen wegen...
Ich wollte darüber nachdenken, wie Menschen, die ständig Marginalisierung(en) erfahren, Diskriminierung(en) erfahren, und trotzdem „da“ sind, präsent sind, zur Ruhe kommen können, sich ausruhen können – in dieser feindlichen Umgebung, die künstlerische Arbeit nach Moden und Buzzwords einsortiert und die sich nicht um die Bedingungen schert, unter denen Menschen arbeiten, miteinander oder auch in Konkurrenz zueinander.
Ich wollte mich mit dem Begriff und Konzept von Ruhe beschäftigen, mit dem „otium“, der Muße. In einer binären Welt funktionieren diese beiden Pole gut miteinander: arbeiten und beschäftigt sein einerseits – „labor“, und quasi als Lohn die Ruhe andererseits. Mich interessierte die Frage nach einer verkörperten Produktivität, also wie durch kapitalistische Anrufungen, Arbeit fast gleichgesetzt ist mit körperlicher Betätigung, inklusive des Denkens, und die Ruhe nur bei völligem „Abschalten“, „Sich-Ausschalten“ möglich scheint, und dann noch als etwas betrachtet wird, das verdient werden muss. Was sind die subtilen Funktionsweisen einer patriarchal-kapitalistisch geprägten Gesellschaft, die sich in unsere Körper einschreiben, und wie zeigen sich diese im Tanz?
Bei der Veranstaltung „Flower, Bells and Water – Decolonizing Turns“, zu der das Chakkars-Team im Juni 2022 in München eingeladen hatte, wurde einige Mal davon gesprochen, dass „das große C“ noch genauer zu untersuchen sei. Im ersten Moment dachte ich, es handele sich um „Capitalism“, stellte aber schnell fest, dass damit „Contemporary“ gemeint war. In gewisser Hinsicht passt es doch, da das westliche Verständnis von „contemporary“ Hand in Hand geht mit kapitalistischen Logiken und Praktiken dominanter westlicher Gesellschaften.[1]
Mittlerweile hängen vielleicht nicht mehr allzu viele an der Illusion, dass „die Kunst“ ja frei sei von diesen ökonomischen Zusammenhängen, dass in der Kunst kreiert, geschaffen und ausprobiert werde. Alle, die von ihrer Kunst leben müssen/wollen, wissen jedoch, dass die enge Verbindung von einer ästhetischen und diskursiven Zeitgenoss*innenschaft mit der Vermarktbarkeit der Ergebnisse künstlerischer Produktion eine Konstante ist.
Dass aber der Begriff der Kontemporaneität, das Zeitgenössische, auch einer im steten Wandel ist und unbedingt von den Umständen abhängt, die sie umgeben, wird meist nicht reflektiert. Wie kann von einem allgemeinen Begriff von „Zeitgenössisch“ ausgegangen werden in einer komplexen und verschiedentlich historisch-soziokulturell geprägten Welt? Wie kann das Zeitgenössische sich orientieren an den verschiedenen gelebten Erfahrungen und Bedarfen der „Genoss*innen"[2], auf die im Hier & Jetzt Bezug genommen wird? Wie kann die erzählende Position (mit) ins Zentrum gerückt werden und nicht allein die interpretierende? Und wie können verschiedene Erzählungen nebeneinanderstehen und in einem vielstimmigem, widersprüchlichem, sich ergänzendem und sich ermutigendem Miteinander aufeinandertreffen?
Und wie wäre es, den Blick auf andere Cs zu richten, die sich als nachhaltigere Orientierungspunkte für eine wider_ständige Präsenz und Co-Existenz herausstellen könnten. Ich schlage vor: Co-operation, Community und Care – oder noch besser, die praktischen Umsetzungen davon: co-operating, creating community, caring.
Es ist nicht leicht, von den Rändern her Raum einzunehmen, sich zu bewegen, eigene Bewegungen zu kreieren. Wie kann ein Umgang mit Anrufungen aus dominanten Positionen aussehen, was können Praktiken des Widerstands sein?
Hier möchte ich einige strategische Fragen teilen, die mir im wider_ständigen Prozess helfen, denn das Widerstehen ist eine kontinuierliche Praxis, die mal besser und mal schlechter gelingt ...
Situierung
Wie bin ich positioniert? Wie ist mein Blick geprägt, auf die Welt und die Fragen, mit denen ich konfrontiert bin? Mit welchem (Un-)Wissen begegne ich anderen Menschen, Dingen und Zusammenhängen? Es gibt keine Neutralität, und jeder Blick, jede Bewegung, jedes Wissen ist situiert. Und ich kann mich auf den Weg begeben, die verschiedenen Aspekte meiner Situierung herauszuarbeiten, um meinen Blick zu schärfen, aber auch um Transparenz zu schaffen.
Noch konkreter wird es, wenn wir über territoriale Situierung sprechen, das Sich-Aufhalten auf einem bestimmten Gebiet. Denn die Geschichte, die sich darauf ereignet hat, nicht nur geprägt von Migrationsbewegungen vor vielen Tausend Jahren, sondern auch durch die jüngere Geschichte, hat Auswirkungen, wer sich wie auf diesem Gebiet bewegt, bewegen darf und nicht mehr da ist. Ich frage mich, wie wir – sich befindend in den Grenzen Deutschlands und verwoben mit der spezifischen Geschichte, das auch Erbe dieses Nationalstaates ist – uns situieren können. Wie sähe ein „land acknowledgement“ aus für ein Gebiet, das zwei Weltkriege verursacht hat, mehrere Genozide verantwortet und erst angefangen hat, die kolonialen Verbrechen der Vergangenheit zu thematisieren. Letztendlich: Wie kann ich mich situieren im Kontext von Gewalt und gewaltvoller Geschichte – woran will ich erinnern, wen will ich sichtbar machen, wie kann ich Verantwortung übernehmen?
Multidimensionalität
Wie klein und einfach erscheint alles, wenn ich eine einzige lineare Erzählung habe. Doch auch das ist eine utopische Praxis, ein Ablenkungsmanöver, die die Komplexität der Welt vertuscht. Wie können Verzahnungen, Verstrickungen, Verwebungen gedacht werden? Wie kann ein Mensch in all den Widersprüchen betrachtet werden, die mit dem Menschsein und In-Gemeinschaft-Sein einhergehen? Wie kann Geschichte nicht auf einer sich stets weiterentwickelnden Zeitschiene gedacht werden, sondern als Spirale oder Strudel oder Streuselkuchen?
Zusammenkunft
What can coming together look like that connects people with each other? What does it take to share a space with each other? What are different formats of coming together that invite different people? What spaces can I create or what spaces do I want to be/move in? Coming together, spending time together, having fun, not feeling pressure – this is already a decolonizing practice – because nothing has to happen in the space except the fact that it is shared.
Gemeinschaft
Der Kapitalismus macht einsam, die hohen Erwartungen an sich selbst machen einsam. Das System, das mir einredet, nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend geleistet zu haben, macht mich einsam – auch wenn ich von vielen Menschen umgeben bin. Wie kann ich der Vereinzelung entgegentreten? Indem ich bedingungslos Gemeinschaft schaffe. Indem ich in Gruppen denke und agiere und mich selbst nicht zu wichtig nehme. Und trotzdem wichtig genug nehme, um mir ausreichend Raum zu nehmen und um auf meine Bedürfnisse zu achten. Jede einzelne Person zählt, aber keine ist wichtiger als die andere. Wie kann ich aus der Gruppe ein Individuum machen, ein Unteilbares, eines, das sich solidarisch miteinander verhält, wertschätzt und respektvoll mit sich umgeht? Das verstehe ich unter „Community“, das Gemeinsame an „Kommunismus“, nicht unbedingt das Gleiche oder Gleichgemachte. Denn um in Bewegung zu bleiben, braucht es die Kraft und Energie von mehreren, wie Zahnräder, die miteinander in Bewegung treten und dranbleiben.
Großzügigkeit
Der Fokus auf den Einzelnen, und was diese einzelne Person „hat“, ob materiell, immateriell, ideell oder in welcher Form auch immer, ist auch eine zutiefst kapitalistische Erzählung. Eine der großen Erzählungen. Dass es darum geht, möglichst genug Polster zu haben, möglichst gut abgesichert zu sein, möglichst viel Rücklagen zu haben etc.
Wie kann ich der Logik des Mangels widerstehen, die mir suggeriert ständig im Hamsterrad laufen zu müssen? Und versteht mich nicht falsch, wir SIND im Hamsterrad, mir geht es um die Geschwindigkeit – müssen wir laufen? Wie kann ich umdenken auf eine Logik der Fülle, des Überflusses? Wie kann ich großzügig mit mir und anderen sein? Wie kann ich das „meinige“ nicht hüten und horden, sondern anerkennen, dass alles, was ich als „meins“ imaginiere, immer aus dem Geteilten von anderen entstanden ist?
Wie kann ich die anderen nicht durch die koloniale Linse sehen: Was habe ich von dieser Person? Was bringt es mir, mit dieser Person in Kontakt zu sein? Sondern einen liebevollen Umgang zu haben. Und zu verstehen, dass „Achtsamkeit“ zu kurz greift, wenn damit nur ich selbst gemeint bin.
Und wenn ich keine Angst habe, dass ich nicht ausreichend bekomme, komme ich auch hoffentlich nicht in die Situation, immer mehr zu wollen, sondern kann Dinge auch sein lassen.
Worte finden, Welt gestalten
Wie spreche ich, über mich, über meine Gedanken, über meine künstlerische Arbeit, über die Welt, über andere? Wie wird über mich und meine Arbeit gesprochen? Sprache schafft Welten, ob gesprochen, geschrieben, gebärdet oder auf eine andere Art und Weise Kommunikation schaffend. Wenn ich Sprache hinterfrage & mitgestalte, kann ich Feinheiten mitdenken, die den Unterschied zwischen Beschreibung, Bewertung und Gewalt ausmachen können. Wie kann ich gegebenenfalls eigene Begriffe erschaffen, um mich einer Vereinnahmung durch eine (vermeintliche) Mehrheitsperspektive zu entziehen?
Methodenkoffer
In der Begegnung mit der Welt sind in meinem Methodenkoffer sehr praktische Werkzeuge, die alle schon in meinen bisherigen Ausführungen durchschimmern.
Das eine ist die kritische Praxis, das kontinuierliche Be- und Hinterfragen, das jedoch auch zielgerichtet ist. Denn zielloses Fragen hat für mich seinen Charme verloren und ist nur noch Sophisterei, also das Fokussieren von Wissen und nicht wozu bzw. wem dieses Wissen zunutze kommt. Und mit der Befragung der äußeren Umstände eng verbunden ist auch die Selbstbefragung, oder eine liebevolle Selbstkritik, damit ich im mir immer Raum lasse für Fehler und Fehlbarkeit, und mich dennoch nicht darauf ausruhe.
Für mich hat (m)ein In-der-Welt-Sein und In-Bewegung-mit-Anderen-Sein immer zum Ziel wie ich den Raum (und Ressourcen) mit anderen teilen kann, wie friedvolle Lösungen für Konflikte aussehen können, wie sich Menschen gegenseitig wertschätzend und respektvoll begegnen können, und wie das alles auf einer Welt mit begrenzten Möglichkeiten machbar ist.
All das hört sich irgendwie machbar an, nach einfachen Praktiken, die dabei helfen können, die ständig präsenten kapitalistischen Verwertungslogiken einer patriarchal geprägten Gesellschaft zu unterwandern. Es gibt kein Außerhalb des Systems. Wie also lässt sich ein kontinuierlicher Widerstand implementieren?
In Bewegung bleiben.
Ich will wieder zurückkommen auf das Ausruhen. Aber nicht als das Sich-Zurückziehen, mal abschalten oder ähnliches. Sondern wie kann ein Ausruhen als eine wider_ständige Praxis aussehen? Welche Aspekte können da mitgedacht werden?
Was brauchen unterschiedliche Körper und unterschiedliche Gemüter in unterschiedlichen Positionierungen, um sich auszuruhen? Was können gemeinschaftlich gedachte Praktiken des Ausruhens sein, des Sich-Rausnehmens? Wie kann die Ruhe in meinem Körper zu der Ruhe in deinem Körper werden, oder umgekehrt? Wie kann ich einen diffraktiven Umgang mit Ruhe entwickeln statt eines reflektiven, der nur auf mich bezogen ist. Denn solange die Ruhe, die Pause, die Auszeit nur auf mich allein bezogen ist, ist es wirklich nur eine Pause, und in dem Moment, in dem ich wieder einsteige, drücke ich wieder auf „play“, ohne dass sich nachhaltig etwas verändert hat. Der Wunsch nach Pause ist nachvollziehbar, die Sehnsucht nach Ruhe und Regeneration. Aber das passendere Bild hierfür ist das einer Batterie, die aufgeladen wird, damit sie sich unter Benutzung wieder entladen kann. Echte systemische Veränderung ist meist nicht möglich, es gibt keinen Rahmen dafür – insbesondere nicht, wenn wir uns jede*r als unteilbares Einziges verstehen. Wenn ich jedoch ein Teil eines verzweigten Netzes bin, ein Knötchen im Rhizom, ziehen wir an unterschiedlichen Ecken und Kurven an Strängen und verändern somit das Gefüge.
Auch das hört sich irgendwie einfach an: Dinge lediglich anders denken. Aber auf das Machen kommt es ja an. Leider gibt es kein Patentrezept, vor allem nicht im Kontext systemischer Ungleichheit, fortgeführter Unterdrückungssysteme, institutioneller Gewalt und strukturellen Ausschlüssen, die auch dazu führen, dass Verantwortung entpersonalisiert wird und sich Menschen ihrer eigenen Beziehung zu ihren Mitmenschen und ihrer Umwelt entziehen und sich auf ihre Rolle oder Funktion zurückziehen. Es gibt bereits viele Versuche, sich diesen ungerechten Bedingungen zu widersetzen. Ein spannender Ansatz ist „Transformative Justice“, das gerade in kolonial ausgebeuteten und wirtschaftsliberal geführten Ländern nicht nur Ersatz für fehlende Sozialsysteme darstellt, sondern einen Umbau gesellschaftlicher Beziehungen bedeuten kann:
Das Einzige, was eine Konstante darstellt: Alles ist im Wandel. [4]
Das Einzige, was eine Konstante darstellt: Alles ist im Wandel.
Daher fordere ich uns auf, in Bewegung zu bleiben, miteinander zu tanzen, gemeinsam etwas zu bewegen – und wenn es sich schnell genug dreht, kann es manchmal sein, als ob es stillstünde – ein Moment der Ruhe, des Loslassens und Sich-Fallen-Lassens. Denn nicht jede Bewegung ist wahrnehmbar, und dennoch wirksam.
[1] Sandra Chatterjee from the CHAKKARs-team has already written valuable texts on these questions:
http://www.corpusweb.net/kulturelle-gleichzeitigkeit.html,
https://www.kiwit.org/kultur-oeffnet-welten/positionen/position_16768.html
[2Im Deutschen gibt es eine Korrespondenz zwischen Zeitgenössisch und Genossen - schaft - d.h. Kameradschaft, Gefährtenschaft, Komplizenschaft - alles schöne inhaltliche Überschneidungen, die im Englischen nicht direkt mit "contemporary" übersetzt werden können, was das Zeitliche in den Vordergrund stellt
[3] “Land acknowledgements” or “territory acknowledgements” are attempts in written or spoken format to draw attention to the presence and land rights of Indigenous people on settled territory. https://native-land.ca/resources/territory-acknowledgement/
[4] At this point, I would like to refer not only to this entry, but to Mia Mingus’ entire blog, where she negotiates key issues that also concern me and generously shares her knowledge and practices:
https://leavingevidence.wordpress.com/2019/01/09/transformative-justice-a-brief-description/
Zitiervorschlag
Bajarchuu, Melmun. 2022. “Resist_ing“ In: Moving Interventions 2: Between Non-cooperation and Community-building Practices of Resilience in dance – through dance – because of dance, December 2022. Edited by / Herausgegeben von: Sarah Bergh and Sandra Chatterjee, with Ariadne Jacoby (CHAKKARs – Moving Interventions), translated into English by: Sandra Chatterjee. eZine published by /veröffentlicht von CHAKKARs – Moving Interventions.
Über die Autorin
Melmun Bajarchuu works at the intersections of art, theory and politics as a thinker and discourse partner, and takes on a variety of roles within collaborative artistic processes, such as critical companion, curator and production manager. She is driven by a desire for a variety of artistic forms of expression as well as to question existing structures and their accompanying power relationships and mechanisms for exclusion. She has a special interest in the interweaving of theories and practices within the context of poststructuralist, post- and decolonial as well as queer feminist perspectives. She is actively involved in the “Initiative für Solidarität am Theater” (Initiative for Solidarity in Theater) and “produktionsbande – network performing arts producers” for intersectional approaches and better working conditions in the performing arts. Since 2020, she has been working as a peer-to-peer consultant in the field of anti-discrimination at the Performing Arts Program Berlin (PAP).