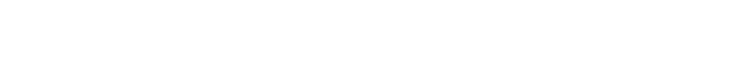Über die Wechselbeziehungen zwischen Alltag, künstlerischer Praxis und Resilienz
Resilienz ist ein wunderschönes Wort, über das wir in unserer Arbeit als KünstlerInnen, aber auch in Bezug auf das Menschsein im Allgemeinen nachdenken können. Es spiegelt die Komplexität von Freud und Leid wider, die die meisten von uns ins Gleichgewicht zu bringen versuchen. Sich zu erholen, zurückzukommen, sich gewöhnen.
Die unvermeidliche Notwendigkeit von Resilienz könnte auf den Ort, von dem aus ich schreibe, nicht besser zutreffen. Ich lebe jetzt seit fast zwei Jahren in Sri Lanka, wo wir in diesem Jahr neben der Pandemie eine schwere wirtschaftliche und politische Krise durchleben mussten. Es war erstaunlich mitzuerleben, wie kreativ die Menschen in der Gemeinschaft mit wenigen Mitteln werden können. Und genau hier möchte ich ansetzen und über den Zusammenhang zwischen Alltag und Resilienz nachdenken.
Es ist mir unmöglich, die Dinge des täglichen Lebens, meine künstlerische Arbeit und meine Strategien voneinander zu trennen. Das, womit ich mich jeweils beschäftige, beeinflusst unmittelbar das jeweils andere. Wenn ich über Resilienz in meinem Leben nachdenke, gelingt es mir nicht, die Herausforderungen zu ignorieren, die meine Familie zu bewältigen hatte. Nie stand überhaupt zur Debatte, unter schwierigen Bedingungen aufzuwachsen und keine Resilienz als Überlebensstrategie aufzubauen – wir mussten es einfach.
Als junge Tanzlehrerin wanderte meine Mutter in den 80er Jahren aus Sri Lanka aus, weil in ihrem Heimatland ein Bürgerkrieg tobte. Mein Bruder und ich wurden von ihr allein großgezogen, während sie in verschiedenen Jobs arbeitete und eine Tanzschule in Berlin aus dem Nichts und ganz allein aufbaute, die sie nun seit 35 Jahren betreibt. Man muss schon extrem resilient und leidenschaftlich sein, um das alles auf einmal zu schaffen. Und genau hier wurde vermutlich auch der Grundstein für meine eigene Resilienz gelegt: in ihrem eisernen Willen, die Schule und die Tamizh-Gemeinschaft um sie herum aufrechtzuerhalten. Mein Vater, der aus Deutschland stammt, ist Musiker, ein brillanter Musiker, aber er kämpft mit einer schweren psychischen Erkrankung und Alkoholismus, und so war und ist seine Musik etwas, das er allein für sich genießt. Ein Publikum ist für ihn ein Albtraum, während meine Mutter vor diesem aufblüht. Aber für meine beiden Elternteile waren ihre Praktiken etwas, das ihnen Freude und Spiritualität vermittelte. Ich habe also immer die Erfahrung gemacht, dass eine kreative Praxis im Leben dazu beiträgt, innerhalb eines Systems Alltagsresilienz aufzubauen, das unsere kreativen und spirituellen Bedürfnisse nicht wirklich berücksichtigt oder kreative Praktiken als wichtige Form des Wissens, der Intelligenz und damit als Beitrag zur Gesellschaft nicht anerkennt. Die meisten Menschen lieben das auf die eine oder andere Art – Musik, Filme, Kultur usw. – aber für Fachleute ist es schwer, in einer Gesellschaft eine grundlegende Akzeptanz unserer Positionen zu erwirken. Da ich Eltern habe, die nicht in den Genuss von offiziellen Fördermitteln kommen und ohne Unterstützung durch eine Elite arbeiten, musste ich zwangsläufig resilient sein, wurde aber auch extrem von ihnen inspiriert. Als KünstlerInnen können wir nicht nur unser Handwerk, sondern auch unsere Menschlichkeit erforschen und haben einzigartige Möglichkeiten, in erster Linie als Menschen zu wachsen. Ich werde in diesem Artikel nicht näher auf die erschwerten Umstände meines Großwerdens eingehen, aber wenn ich über Resilienz in der Kunst nachdenke, erlebe ich wirklich, dass hier das Prinzip der Bilateralität greift: Ich werde im täglichen Leben durch meine künstlerische Praxis resilienter, werde aber auch in meiner Arbeit durch die Erfahrungen des täglichen Lebens in unserer Gesellschaft und durch das, was erforderlich ist, um weiterzumachen, resilienter: denn das Leben begegnet uns mit Grausamkeit und Glück gleichermaßen. Generell, mit einem Hintergrund in der Arbeiterklasse im Kunstbereich tätig zu sein, wo vergleichbar sehr wenige mit solch einem Hintergrund in diesem Feld arbeiten, vor allem zusätzlich mit einem Migrationshintergrund, glaube ich nicht, dass ich es überhaupt durch eine Kunstshochschule mit ihren inhärenten, meist unausgesprochenen Codes geschafft hätte. Früh schon lernen wir die Vielfalt der sozialen Codes kennen, und wie man mit ihnen umgeht und sich anpasst, um an verschiedenen Gruppen teilzunehmen.
Ich beschäftige mich seit 29 Jahren intensiv mit der Tanzform Bharatanatyam. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der mich der Tanz nicht begleitet hat, denn ich begann meine Ausbildung im Alter von vier Jahren an der Schule meiner Mutter. Nach vielen Jahren harten Trainings, Studierens, Auftretens, Unterrichtens und der Teilnahme an einem pulsierenden Gemeinschaftsleben (keineswegs frei von herzzerreißenden inneren Konflikten) folgte eine Zeit, in der ich begann, mich wegen einiger Fragen, die ich an den Tanz hatte, unwohl zu fühlen. Fragen in Bezug auf sein Antik-Sein, seine VorgängerIn, wie wir hier gelandet sind, seine moderne Inszenierung, seinen Glamour und insbesondere auf die Gründe für die zugewiesenen Attribute klassisch und mit unseren Tänzen zu traditionell. Diese Fragen stellten sich mir, als ich 17 war, aber es erforderte mehr Zeit, sie zu verstehen und mit ihnen zu reifen. Ich studierte die Geschichte des Tanzes, die Kolonialisierung und erforschte die breiter aufgestellten nationalen Projekte der kulturellen Wiederbelebung in Südasien nach der Unabhängigkeit. Durch diesen Prozess wurde mir klar, dass meine Fragestellungen für mein persönliches Wachstum als Künstlerin wichtig waren. Erst Jahre später begriff ich, dass die Annäherung an den Tanz nicht nur über seine Ausbildung, Theorie, Musik und Mythologie, sondern auch über eine kritische Linse, den Kontext und die Philosophie erfolgte und mit der Zeit zum Aufbau von dekolonialen Strategien führte. Dies war insbesondere aus der Diaspora heraus ein schwieriger und einsamer Prozess: einerseits klammerte sich meine Community an ein Verständnis von Traditionen als statische, althergebrachte Praktiken, die es als kulturelles Erbe zu bewahren und weiterzugeben gilt (ein üblicher diasporischer Ansatz), andererseits fiel es einer deutschen zeitgenössischen Tanzszene schwer zu begreifen, womit ich mich beschäftige und warum es überhaupt relevant ist – warum tanze ich nicht einfach zeitgenössisch und mache, was ich will, ach so frei?! Das kam für mich nicht in Frage, da ein Teil meiner Arbeit eine Kritik an der westlichen universellen Fortschrittlichkeit ist und ich mich nicht von der
überlieferten Linie meiner künstlerischen Praxis trennen wollte, die keine Ursprünge im Westen hat.
Daher benötige ich einen anderen Ansatz. So schwierig das auch ist – es ist ein politischer Standpunkt. Ich glaube nicht, dass eine Person etwas in einem Leben dekolonisieren kann oder dass wir notwendigerweise zu einer „authentischeren“ Version der Praxis dieses Tanzes (Bharatanatyam) im Besonderen „zurückkehren“ können oder sollten. Daher verwende ich gerne die Formulierung dekoloniale Strategienda dies eher auf eine Methodik und einen Ansatz als auf ein Ziel hinweist. Diesen ganzen Prozess zu durchlaufen dauert viele Jahre , und ich persönlich verstehe ihn als etwas, dem ich meine Arbeit im Allgemeinen widme, weshalb meine Stücke oft miteinander verbunden sind, da sie aufeinander aufbauen. Im produktionsorientierten Bereich der darstellenden Künste erfordert eine solche Herangehensweise eine gehörige Portion Resilienz. Diese Herangehensweise, nämlich der kreativen Arbeit zu erlauben, sich organisch zu entfalten und zu wachsen, ermöglicht es mir, auf diesem Weg zu bleiben, der von von einem Hauptaspekt inspiriert ist. Es geht nicht um mich und ist größer als ich allein. Und das verschafft mir Resilienz. Ich erkenne die Notwendigkeit an, mich anzupassen oder neu zu positionieren, wenn etwas nicht funktioniert oder (auch künstlerisch) überdacht werden muss, und erinnere mich immer wieder daran, dass es darum geht, Teil eines größeren Diskurses zu sein – und das lässt mich weitermachen.
Da ich aus der Tamizh Diaspora in Deutschland stamme und in Europa arbeite, besteht ein großer Teil meiner Arbeit darin, wie ich diese Fragestellungen weitergeben kann. Die Art und Weise, wie ich sie in Inszenierungen präsentiere ist entscheidend geworden, denn es ist eine Herausforderung, sie mit einem Publikum zu teilen, das vielleicht einfach nur den Tanz in seiner ganzen Pracht sehen möchte. In meiner Arbeit frage ich, was Tanz für die innere Erfahrung der TänzerInnen, aber auch für die ZuschauerInnen bedeutet. Es gibt den inhärenten Aspekt der dominanten Bedeutung, die dem Tanz als visuelle Erfahrung beigemessen wird, und hier kommen die Herausforderungen des Blicks, die Exotisierung und die Repräsentation ins Spiel. Aber anstatt vehement dagegen anzugehen, überlege ich mir lieber poetische Wege, die die ZuschauerInnen dazu einladen, sich auf den Tanz einzulassen. Nachdem ich mit Mitte zwanzig politisch anspruchsvollere ästhetische Strategien ausprobiert hatte, wurde mir bald klar, dass mich diese Energie nicht so sehr interessiert. Drängende gesellschaftspolitische Fragen ließen mich auf Wegen gehen, auf denen ich Fragen nach der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit erkundete. Doch anstatt unablässig einen tanzenden Körper ins Rampenlicht zu rücken und die philosophischen Bedeutungen zu betonen, die mit der Idee des Rampenlichts einhergehen (wenn wir erst einmal empowered/repräsentiert sind – was ist das Rampenlicht des Weiteren als Ästhetik der modernen Inszenierung?), interessierte ich mich dafür, was geschieht, wenn wir das poetische Potenzial des Unsichtbaren, der Abwesenheit und des Dazwischens erkunden. Im Laufe der Zeit hat sich daraus schließlich eine künstlerische Praxis entwickelt. Wenn wir nicht sehen, hören wir zu, vielleicht sogar genauer. Und so begann ich, die klanglichen Aspekte des Tanzes, Bharatanatyam, durch eine Praxis des Zuhörens zu erforschen. Dabei stellt sich die Frage, was Tanz ist, wenn wir das, was er darstellt, überwinden können. Und so gelang es mir, seinen sensorischen Kosmos zu erschließen. Obwohl ich einige Jahre brauchte, um diese Strategien zu entwickeln, weg von einer eher konfrontativen Reaktion auf das Otheringhat sich dieser Prozess für mich in etwas viel Wertvolleres verwandelt: in eine künstlerische Praxis, durch die ich erforsche, wann visuelle Schranken uns auf sich bewegende Körper herunterbrechen, die visuell kategorisiert und beurteilt werden. Wirklich befreiend war für mich, nicht bei den Themen eines exotisierenden Blicks zu verharren, sondern künstlerische Werkzeuge zu entdecken und zum poetischen Potenzial des Tanzes überzugehen, das mir Resilienz gegeben hat. Da Rassismus kein Thema ist, das ich erdacht habe, möchte ich einfach verhindern, dass er meine künstlerische Arbeit einschränkt, denn neben meinen kritischen Fragestellungen ist der Tanz für mich auch nicht nur ein spirituelles und ganzheitliches Medium – auf sehr undogmatische Weise – sondern auch eine Lebensphilosophie. Und es ist mir wichtig, dass der Rassismus mir und denjenigen, die sich damit befassen wollen, das nicht nehmen kann. Und das wiederum ist ein politischer Standpunkt. Es gibt immer Menschen, die nicht bereit sind
einfach ZeugInnen und mit unseren Tänzen zu sein ,
ohne sie und unsere Anwesenheit rechtfertigen zu müssen. Ich habe verletzende Erfahrungen mit Menschen gemacht, die mich in Bezug auf meine Identität in die Enge getrieben haben, und zwar nicht nur, weil es derzeit sehr in Mode ist, sondern weil ich den Eindruck habe, dass das derzeitige von Aktivismus geprägte Klima in den darstellenden Künsten auch von einer selbstlobenden Energie geprägt ist. Ich stehe voll und ganz hinter den Grundprinzipien, da sie auch einen Großteil meiner Arbeit bestimmen, aber ich beobachte heute eine gefährliche neue Dynamik. Das Tätigkeitsfeld, das uns bisher ausgeschlossen hat, sagt es uns jetzt, wer wir sind, wie wir unsere Identitäten darzustellen haben, es setzt uns unter Druck, uns innerhalb unserer Tanzstücke zu erklären. Und auf diese Art und Weise
nehmen sie dem Tanz denTanz weg
und damit auch uns. Und da der Tanz ein flüchtiges Medium ist mit einem großen Potenzial, das zu erforschen, was über die Sprache hinausgeht – und genau das interessiert mich – möchte ich nicht jede Arbeit auf Erklärungen zu meiner Identität reduzieren. Es gibt immer andere Situationen und Medien, auf die ich zurückgreifen kann, z. B. das Schreiben, das mir auch Freude bereitet. In einem meiner Stücke habe ich zum Beispiel meine persönlichen Erfahrungen mit der Tanzform durch das gesprochene Wort in einen Kontext gesetzt. Das habe ich gern getan und würde es auch gern wieder tun, wenn es dem Stück dient. Aber auch hier weigere ich mich, dies in jedem einzelnen Stück zu tun, immer und immer wieder von Grund auf neu für jeden neuen Kontext. Ich unterhalte mich oft mit KünstlerkollegInnen darüber, und sie berichten sehr oft von ähnlichen oder denselben Gedanken und Erfahrungen, aber da wir heute auf diese Weise in das Feld eingeladen werden, sehen einige keine andere Möglichkeit. Und deshalb glaube ich, dass wir von Gleichberechtigung noch weit entfernt sind. Weiße ChoreographInnen müssen sich nicht in jedem neuen Kontext immer wieder neu erklären. Wir sind es, die sich gut artikulieren müssen und sich allem bewusst sein müssen, die sich in der Öffentlichkeit immer wieder verletzlich zeigen müssen, die ihre Privatsphäre ausbeuten lassen müssen und kaum eine Chance bekommen, als KünstlerInnen und DenkerInnen ernst genommen zu werden. Und hier finde ich meine Resilienz, indem ich meine künstlerische Integrität nicht aufgebe, um mich besser einzufügen. Das kann manchmal einsam machen, aber in den letzten Jahren hat es mir wirklich ermöglicht, als Choreografin zu wachsen und mich zu entwickeln, herauszufinden, was für mich funktioniert und was nicht, und die richtigen Orte, Menschen und Gemeinschaften zu finden, die solche oder ähnliche Ansätze begrüßen und praktizieren. So kann aus einer schwierigen Situation etwas Wundervolles entstehen, und wenn ich geduldig genug bin, erlebe ich fast immer, dass ich auf einem Boden ankomme, der mich anspricht und berührt und wo man mir nicht mit herablassendem Ton begegnet. Und obwohl das Ansprechen von Dingen und die Konfrontation eine wichtige Strategie ist, habe ich auch gelernt, meiner Intuition zu vertrauen und mir zu erlauben, ohne Diskussion wegzugehen. Fragen meiner Identität stehen nicht immer zur Diskussion, vor allem dann nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person nicht in der Lage ist, mir offen zuzuhören und nur erwartet, dass ich in ihrem Denkrahmen oder ihrer Ausdrucksweise spreche. und da gilt es, meine Energien zu schonen, vor allem, nachdem ich viel Zeit und Energie in einen eher konfrontativen Ansatz im Umgang mit Ignoranz in diesem Bereich investiert habe.
Das folgende Zitat der außergewöhnlichen Choreografin Chandralekha sind Zeilen, auf die ich mich schon seit Jahren beziehe und die noch immer aktuell sind:
„Ich habe mich zunehmend an der aktuellen westlichen kritischen Meinung gestört, die so mühelos
östliche „Traditionen“ auf unkritische Weise und ausschließlich aus einer
orientalistischen und herablassenden Perspektive heraus verherrlicht und wertet. Für uns, in unseren östlichen Kontexten, sind sowohl unsere
„Traditionalität“ und „Modernität“ komplexe und problematische Bereiche , die keine abstrakten
theoretischen Kategorien darstellen, sondern reale, alltägliche Bedenken – sowohl das Leben als auch die darstellende Kunst betreffend“. [1]
Auch heute noch bin ich immer wieder erstaunt über die Ignoranz gegenüber anderen Kulturen, die komplexen Realitäten unseres Lebens und nun auch über die überzeugte Arroganz weißer Menschen, die sich als unsere Retter anpreisen und uns belehren – schon wieder - aber diesmal auf politisch „korrekte“ Art und Weise, die meiner Meinung nach schockierend engstirnig ist. Vielleicht ist dieser Drang, sich so etwas herauszunehmen, einfach tief in der westlichen Kultur verankert. Zum Glück trifft man auch wunderbar sensible, bescheidene Menschen mit grundlegendem Respekt vor anderen, und diesen möchte ich mehr Aufmerksamkeit schenken. Dadurch verschiebt sich die Machtdynamik: Wertschätzung, Bestätigung, Anerkennung oder auch nur Zustimmung oder Ablehnung sind keine Einbahnstraße. Ich bin selbst autonom und handlungsfähig genug, um dasselbe für mich in Bezug auf mein Tätigkeitsfeld zu entscheiden und fühle mich in keiner Weise verpflichtet, Erwartungen zu erfüllen, mit denen ich nicht einverstanden bin oder die ich problematisch finde. Und hier eine gute Balance hinzubekommen kann extrem empowernd sein. Ich habe zwar absolut nichts dagegen, intime Einblicke in meine Biografie zu gewähren und meine Identität in der breiteren Gesellschaft in einen Kontext zu setzen, aber wenn ich in jedem Arbeitskontext damit konfrontiert werde, wird es einfach anstrengend! Früher wurden wir an den Rand gedrängt – jetzt sind wir zu einem trendigen Fetisch verkommen. Und während es mittlerweile großartige Impulse für die Öffnung des Feldes für andere kulturelle Perspektiven gibt, die ich begrüße und von denen ich sicherlich auch in gewisser Weise profitiert habe, besteht auch gleichzeitig die Gefahr, dass wir in Fragen der Repräsentation stagnieren und uns nicht erlauben, die choreografische Arbeit zu machen, die einst als Inspiration dafür gedient hat, überhaupt ChoreografInnen zu werden. Ich habe oft den Eindruck, dass unhinterfragtes Lob dafür erwartet wird, dass sie für unsere Repräsentation kämpfen und einen weißen Blick herausfordern, während sie uns noch immer bevormunden und allein aus ihrer Perspektive heraus entscheiden, was wertvolle Kunst ist und was nicht. Das ist und kann einfach nicht genug sein, wenn es ihnen wirklich wichtig ist, dass ihre Kunst und ihre akademischen Tätigkeitsfelder so international und inklusiv sind, wie sie behaupten. Dies ist lediglich einer von vielen weiteren Schritten.
Vor diesem Hintergrund war es für mich von entscheidender Bedeutung, Räume, Arbeitskontexte und Bildungseinrichtungen zu finden, die transparent sind und einen interdisziplinären Zugang zur Kunst zulassen und anbieten, da solche Überlegungen und Betrachtungen einen Blick über den Tellerrand der eigenen Disziplin hinaus erfordern; Räume, die Raum für Lernen und Zuhören in beide Richtungen ermöglichen und offen dafür sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn man Fehler macht. In interdisziplinären und künstlerischen Forschungsumfeldern bekommt man auch die Chance, die Verbindungen und die Relevanz des Tanzes in einem breiteren Kontext zu erforschen und sich auszutauschen. Man bekommt die Möglichkeit, spezifische Medien zu wählen, die für verschiedene Fragestellungen geeignet sind. Obwohl ich auch hier mit Herausforderungen zu kämpfen habe, schätze ich mich glücklich, solche Institutionen und Arbeitsumgebungen gefunden zu haben, die keine autoritären Hierarchien aufweisen, sondern KünstlerInnen die Möglichkeit geben, sich Gehör zu verschaffen und an der Gestaltung ihrer Programme mitzuwirken. In dieser Hinsicht bieten solche Räume eine bidirektionale Art des Lernens und damit auch einen Gemeinschaftssinn. Abgesehen davon glaube ich fest an von KünstlerInnen ins Leben gerufene Initiativen, die meiner Meinung nach die resilienteste Antwort auf Diskriminierung, Ausgrenzung und reduzierende Trends in diesem Bereich sind. Da ich als Teil der srilankischen Tamizh-Gemeinschaft in Berlin aufgewachsen bin, habe ich schon früh die Kraft der Gemeinschaft und der Organisation von der Basis aus erfahren. Und so sehr wir auch einen Platz in den (kulturellen) Zentren bekommen sollten, bleibe ich inspiriert von den Möglichkeiten kleinerer Kontexte und sogar der Ränder: Sichtbarkeit und die Möglichkeit, im Mittelpunkt zu stehen, sind wichtig, aber Teil unserer dekolonialen Arbeit ist es auch, die Machtkonzentration in diesen Zentren zu hinterfragen. Ich möchte nicht um der Sichtbarkeit willen ständig an allem teilnehmen und so mit meinen Prinzipien und Werten brechen. Und die beste Möglichkeit, auf diesem Weg zu bleiben, sind Allianzen – gleichgesinnte KollegenInnen, Freundschaften und Kulturschaffende sowie die Konzentration auf das große Ganze. Natürlich sind größere Produktionen und Theater immer eine spannende Möglichkeit, aber in diesem unsicheren Bereich ist es für mich ein Muss, flexibel zu bleiben, um diesem Bereich hinsichtlich künstlerischer Freiheit und Einkommen überleben zu können. Und diese Flexibilität wird zu einer Form der Resilienz.
Da mir die Produktionsweise in der darstellenden Kunst nicht sofort zusagte, hat mir die Suche nach meiner Praxis mit dem Schwerpunkt auf künstlerischer Praxis und Forschung als Grundlage, die sich auf unterschiedliche Weise und mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten in den Stücken manifestieren, ermöglicht, einen Ansatz für das „Dance Making“ zu finden, der sich für mich persönlich organischer und nachhaltiger anfühlt. Obwohl es viel Zeit und Geduld erfordert, schafft es einen Nährboden für die Entstehung eines Werkes und gibt dem Alltag Regelmäßigkeit. Und dadurch wiederum wächst das Vertrauen in das eigene Tun und die eigenen Absichten: Kein ignoranter Kommentar, keine Ablehnung, keine grundlose Predigt oder engstirnige Kritik kann einem das nehmen.
Hier gelange ich zu der Einsicht, dass ich kein Interesse daran habe, nur für ein weißes Publikum oder einen weißen Blick zu arbeiten, denn das, womit ich mich beschäftige, betrifft nicht nur weiße Menschen. Ich bin auch nicht bereit, die poetische und ephemere Natur des Tanzes aufzugeben und sie PoCs und den ZeugInnen wegzunehmen, die Werken aus einem anderen kulturellen Hintergrund nicht mit Misstrauen begegnen. Meine Arbeit ist auch für sie und natürlich für mich selbst. Daher ist es mir elementar wichtig, nicht nur in Europa zu arbeiten (abgesehen von diasporischen Kontexten), sondern mit lokalen Szenen und KünstlerInnen in Südasien verbunden zu bleiben. Als kritische Künstlerin hat man es sowohl mit einem Othering westlichen Blick zu tun, als auch mit einem konservativen Blick durch eine verzerrte Geschichte aus den eigenen Reihen – ob in der Diaspora oder in der Heimat unserer Vorfahren. Beide Seiten müssen gleichermaßen thematisiert werden, und die Konzentration auf einen weißen Blick allein verzerrt diese Realität. Ich bin dankbar, dass die Szene in Sri Lanka mich seit Jahren willkommen heißt und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, an der Universität von Peradeniya ein Forschungsprogramm zu absolvieren. Das ist für mich sehr bedeutsam und gibt mir Raum und eine Gemeinschaft, in der diese Tanzpraxis eher zu Hause ist. Außerdem habe ich KollegInnen in Indien und fahre so oft wie möglich dorthin, in Zukunft noch häufiger, wenn möglich. Mit gleichgesinnten KünstlerkollegInnen hier und in der Diaspora verbunden zu sein, ist für mich eine der größten Quellen der Resilienz. Und obwohl ich die Länder hier als Nationen bezeichne, sind sie kulturell gesehen keineswegs getrennte Einheiten. Es gibt ein zusammenhängendes Netz kultureller und spiritueller Praktiken, die historisch miteinander verbunden sind und die sich in Süd- und Südostasien über Jahrhunderte hinweg verschoben und gegenseitig beeinflusst haben. So sehr ich auch der Meinung bin, dass wir die Eigenart lokaler Kontexte abseits von nationalistischem Denken schützen sollten, besteht ein Teil der Arbeit auch darin, unsere gemeinsame Geschichte und Praxis anzuerkennen und zu begreifen, wie der Nationalismus nach der Unabhängigkeit diese darstellt und trennt. Und das gilt auch für diasporische Kontexte, in die diese Praktiken mitgebracht werden. Und diese Kontextualisierung vermisse ich wirklich in den postkolonialen Diskursen in Europa.
Diasporas sind komplex und unterschiedlich. Manche gleichen eher einer Blase, andere wiederum sind miteinander oder auch mit dem jeweiligen Heimatland verbunden. Meine Erfahrung als srilankisch-tamilisch-deutscher Mensch ist nicht die gleiche wie die eines türkisch-deutschen Menschen oder eines Afroamerikaners. Nicht jeder hat die Möglichkeit, mit seiner angestammten Heimat verbunden zu sein, und ich bin dankbar, dass ich das von frühester Kindheit an war. Auch diese Realität geht in vielen Gesprächen über die Diaspora in Europa, die oft auf ein einzelnes, isoliertes Phänomen verengt werden, völlig unter. Die Kontextualisierung sowohl des Lokalen und des Globalen, als auch sich bescheiden und respektvoll der Materie zu widmen, führt zu einer weiteren Strategie der Resilienz: einem dreifachen Ansatz der Verantwortlichkeit:
Erstens, mich selbst immer wieder zur Rechenschaft zu ziehen, meiner eigenen Arbeit und meinen Absichten kritisch zu begegnen und Fehler oder das, was nicht funktioniert, anzuerkennen. Ich glaube, man muss bei sich selbst anfangen und kann nur dann wachsen, was eigentlich „nur“ innere Arbeit ist. Und langfristige kollegiale Beziehungen für Dialog und Feedback zu pflegen, hilft dabei sehr. Dies bildet eine Grundlage dafür, sich nun den äußeren Problemen zuwenden zu können.
Zweitens den Kolonialismus zur Rechenschaft zu ziehen, den fortbestehenden postkolonialen Zustand, auf dem der Kapitalismus fußt sowie das nach wie vor problematische Othering „anderer“ kultureller Ästhetiken in den darstellenden Künsten, während der Westen sein eigenes Bedürfnis nach historischer Kontextualisierung seiner Zeitgenossenschaftignoriert und Anspruch auf universelle Fortschrittlichkeit und Objektivität erhebt.
Und schließlich der Blick in die eigenen Reihen, der nationalistische Missbrauch und die Verzerrung „alter Traditionen“ sowie die kulturelle Propaganda nach der Unabhängigkeit, vielleicht als Antwort auf den Kolonialismus, von der zugrundeliegenden Strategie jedoch nur profitabel für die gesellschaftliche Oberschicht, während örtliche Minderheiten marginalisiert wurden. Hinzu kommt die Assimilierung westlich-klassisch ästhetischer Ideologien in die lokalen Künste, wodurch viele einzigartige Qualitäten ausgelöscht wurden (ein Beispiel sind die mikrotonalen Tonleitern in der karnatischen Musik, karnāṭaka saṅgītam, die auf eine gleichstufig temperierte Stimmung reduziert wurden).
Als Praktikerin ist die größte Herausforderung, dass man es nicht nur mit Theorien zu tun hat, sondern eben mit Praktiken, was jedoch gleichzeitig das ist, woran ich am meisten Freude habe. Für mich ist das ein dekolonialer Ansatz für Wissenssysteme an sich, da er die Produktion von Wissen und das, was überhaupt als Wissen gilt, infrage stellt. Aber es braucht wiederum Zeit und Geduld, damit diese Aspekte aufeinandertreffen und in ein Gleichgewicht gebracht werden können.
Geduld ist hier eine zentrale Kraft für Resilienz.
All das, was ich beschrieben habe, war und ist ein jahrelanger Prozess, bei dem es darum geht sich aktiv mit den Problemen zu beschäftigen. Doch in den letzten Jahren bin ich in einem neuen Kapitel angekommen, was sich wie ein Neuanfang anfühlt, inspiriert von all den einzigartigen und schönen Möglichkeiten, die die Kunst zu bieten hat. Und sie inspirieren mich, resilient zu bleiben. Jenseits davon, in ständiger direkter Reaktion zu Rassismus zu sein, öffnet sich der Kosmos, dem ich mich schon fast drei Jahrzehnte lang gewidmet habe, weiter und offenbart Dinge, die ich noch lernen und erforschen möchte, sowie im Austausch mit anderen praktizierenden zu stehen. Sich darauf zu konzentrieren ist ein politischer Standpunkt, eine Antwort auf Rassismus und eine Strategie für Resilienz.
Ich möchte mit vielleicht naheliegenderen, aber nichtsdestotrotz wichtigen Strategien für Resilienz schließen: Fürsorge für geliebte Menschen und für andere Lebewesen – denn warum sollte man sich immer nur auf den Menschen konzentrieren? – sowie die Praxis der Selbstfürsorge: Für mich bedeutet das, mich zurückzuziehen, durch Körperpraxis auf meinen Körper zu achten, in der Natur zu sein, spazieren zu gehen, gut zu essen, zu kochen, was ich ebenso gerne für und mit anderen tue wie für mich selbst. All das sind verschiedene Formen der Meditation, die helfen, die Energie wiederherzustellen, die man braucht, um sich dem komplizierten Gebiet der Kunst zu stellen. Und obwohl der Gemeinschaft oft viel Bedeutung beigemessen wird, tue ich diese Dinge auch sehr gern allein, abseits des Geschwätzes, um den Geist zu zentrieren.
Stille ist eine lebendige Quelle.
Und schließlich, so sentimental das auch klingen mag – aber ich kann es einfach nicht auslassen – ist eine wichtige Form der Resilienz für mich die
Liebe:
Liebe zum Tanz,
Liebe zu den KollegInnen,
FreundInnen
zu denjenigen, die vor uns waren,
die jetzt bei uns sind
und ja,
auch das Verliebtsein,
das über enorme Kräfte Verfügen, um Gefühle
der Frustration,
des Alleinseins,
des sich Besiegt-Fühlens, zu überwinden,
hoffnungslos gegenüber unserer eigenen Spezies
- Wie können wir als Wesen gleichzeitig so
bemerkenswert und närrisch,
einfühlsam und gewalttätig sein? -
Und so glaube und fühle ich, dass das Lieben
und Geliebtwerden die beste Strategie ist um
resilient zu sein und zu bleiben.
um weiter zu machen.
[1] Chandralekha. Reflections on New Directions in Indian Dance, in Davesh Soneji’s Bharatanatyam, A Reader. Oxford University Press, 2010, 378.
Zitiervorschlag
Mikolai, Sara. 2022. “On the interrelations between everyday life, artistic practice and resilience“ In: Moving Interventions 2: Between Non-cooperation and Community-building Practices of Resilience in dance – through dance – because of dance, December 2022. Translated (from English to German) by: Anja Tracksdorf (Tracksdorf Translations). Edited by / Herausgegeben von: Sarah Bergh and Sandra Chatterjee, with Ariadne Jacoby (CHAKKARs – moving interventions). Published by /veröffentlicht von CHAKKARs – moving interventions.
Über die Autorin
Sara Mikolai is a choreographer and interdisciplinary artist from Berlin. In her work she focuses on a critical and poetic engagement with epistemologies of dance through somatic practice, philosophic reflection and balancing an equilibrium of contextualizing the personal, historical and con-temporary in art and everyday life. Through an interdisciplinary approach she mainly works with live performance, sound, video, installation, research and writing. She trains in and studies Bharatanatyam since 1994, initially under her teacher and mother Diana Mikolai at the Abhinaya Dharpana School for Indian dance in Berlin. She graduated in BA Dance, Context & Choreography at HZT Berlin, as well as in the MFA in Performing Arts program at the Iceland University of the Arts. Further she holds a diploma in Bharatanatyam from the Oriental Fine Arts Academy of London. Currently she is doing research in the MPhil in Fine Arts postgraduate program at the University of Peradeniya, Sri Lanka.